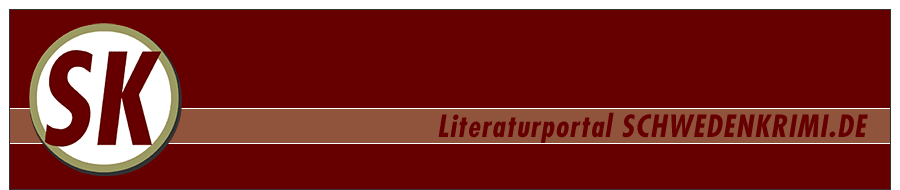Schreibt Camilla Läckberg einen „Lifestyle-Thriller“? – Betrachtungen von Außen
„Die Töchter der Kälte“, Camilla Läckbergs dritter auf Deutsch vorliegender Fjällbacka-Krimi, ist gut komponiert und spannend konstruiert, bietet aber nichts Neues – das provoziert ihre Kritiker. Ihre Fans aber, und davon gibt es reichlich, werden auch diesen Krimi mit den beiden Protagonisten Erica und Patrick lieben, denn die Schwedin bleibt sich und ihren Figuren treu.
Als Henning Mankell sich Ende der 1990er Jahre anschickte, mit Kurt Wallander auch den deutschen Markt zu erobern, tat er dies mit einem Protagonisten, der die Welt nicht mehr verstand und fast daran verzweifelte. Die zehn Bände um Kurt Wallander sind zu einem linkskonservativen Manifest geworden. Es ist dies in weiten Teilen der Abgesang auf vergangene, verlorene Werte. Gleichzeitig aber lieferte Henning Mankell gesellschaftliche Analysen auf der Höhe seiner Zeit. Jeder Mordfall, jeder Kriminalroman diente dem Autoren, exemplarisch Niedergang, Verfall, Krankheit und Tod einer vergangenen Gesellschaft, insbesondere dem schwedischen „Volksheim“, aufzuzeigen.
Camilla Läckberg steht für eine neue Stilrichtung
Kurze Zeit später tauchte Liza Marklunds Annika Bengtzon auf der Bildfläche auf und sorgte ebenso für Furore wie davor Henning Mankell. Wiewohl sich Marklund und Mankell, Wallander und Bengtzon äußerlich und im literarischen Konzept auch unterscheiden, kritisierte doch auch Marklund seinerzeit soziale Kälte und gesellschaftliche Entwicklungen, die Menschen zu Mördern werden ließen. Gleichzeitig dokumentiert(e) sie mit der berufstätigen Mutter Annika Bengtzon soziale Realität. Inzwischen, rund zehn Jahre sind seit den Aufsehen erregenden Kriminal- und Gesellschaftsromanen eines Henning Mankell und einer Liza Marklund vergangen, dominieren längst andere Autoren die literarische Bühne, darunter auch Camilla Läckberg, der die «Brigitte» attestiert, „besser als Liza Marklund“ zu sein. Das sagt einiges über die vergangene Dekade aus, die große Autoren wie Håkan Nesser und Arne Dahl hervorgebracht hat. Seit etwa drei, vier Jahren jedoch zeichnet sich eine zu den gesellschaftskritischen, zum Teil hoch-literarischen und intellektuellen Romanen gegenläufige Tendenz in der skandinavischen Kriminalliteratur ab, für die Camilla Läckberg und ihre Schriftstellerkolleginnen Sara Blædel, Kajsa Ingemarsson oder Mari Jungstedt beispielsweise stehen.
Von Pisse, Möwenscheiße, Neid und Sexismus
Das Wort vom „Lifestyle-Thriller in kriminellem Milieu mit Frauen als Protagonisten“ machte die Runde, eine „Feminisierung“ des Kriminalromans wurde konstatiert – und gemeint war wohl auch eine Trivialisierung des skandinavischen Krimis. Im August diesen Jahres kulminierte die bis dato zumindest sachlich vorgetragene Argumentation in der Verbalattacke des Schriftstellerkollegen, Kriminologen und Medienexperten Leif GW Persson, der Läckberg vorwarf, was sie schreibe, passe allenfalls als Kitschnovelle in Pferdezeitschriften. Läckberg konterte, indem sie dies als „Pisse von einem älteren Herrn“ abtat, „der sich irgendwie übergangen fühlt“. Es schalteten sich weitere Protagonisten ein (Annika Bryn, Mari Jungstedt, Ernst Brunner), weitere Namen wurden ins Spiel gebracht (Liza Marklund), weitere Beschimpfungen machten die Runde („Möwenscheiße“), und die Trennlinie verlief ziemlich genau zwischen älteren Männern und jüngeren Frauen, und in dieser Logik völlig konsequent war weiters von „Neid“ und „Sexismus“ zu lesen.
Paarbeziehungen bei Camilla Läckberg
Tatsächlich bietet Camilla Läckbergs dritter, nun auch auf Deutsch vorliegender Krimi „Die Töchter der Kälte“ genügend Angriffsfläche für oben erwähnte Kritik. Der Mord an der erst siebenjährigen Sara ist der Ausgangspunkt für das zentrale Thema dieses Krimis, nämlich den diversen Beziehungen und Beziehungstypen zwischen Eltern und Kindern. Ausführlich wird etwa Ericas postnatale Depression beschrieben, aber auch, dass insbesondere für Patrick das Familienleben mit Erica und Maja der dringend benötigte Zufluchtsort ist, wo er Kraft für die tägliche Polizeiarbeit schöpfen kann. Es wird auch kein Zweifel daran gelassen, dass die Entscheidung für ein Kind grundsätzlich die richtige war. Problematische Eltern-Kind-Beziehungen tauchen bei Läckberg eher auf Seiten der Bösen auf, und auch wenn es dazwischen ein diffuses Grau gibt – zum Beispiel ein pädophiler Vater, der aber immerhin seinen eigenen Sohn verschont –, Patrick und Erica gehen trotz ihrer Probleme unbeschadet aus dem Ganzen hervor und präsentieren, weil sie die Protagonisten sind, zweifellos die als ideal dargestellte Paarbeziehung. Beziehung und Partnerschaft, Kind und Ehe sind damit bei Läckberg das signifikante Gegenbild zu den einsamen, verlassenen, eigenbrötlerischen Polizisten wie Wallander, aber auch zu den mit Kind und Karriere kämpfenden Frauen wie Annika Bengtzon und Ann Lindell. Doch sollte man der Autorin daraus einen Strick drehen? Nein, denn es ist genauso legitim, diese Ansicht zu zeigen, wie auch die vom desillusionierten Mann in der Midlife-Crisis oder die von (alleinerziehenden) berufstätigen Müttern.
Das konservative Element bei Camilla Läckberg
Das Problematische oder Kritikwürdige daran ist vielleicht eher, dass man das Gefühl hat, hier wird ein längst vergangener Status quo konserviert. Das wird vor allem beim seriellen Schreiben beziehungsweise Lesen erkennbar. Das, was Henning Mankell und Liza Marklund und mit ihnen beziehungsweise in ihrer Folge beispielsweise Håkan Nesser und Arne Dahl vor allem inhaltlich für das Genre bewirkt haben, scheint bei Camilla Läckberg (wieder) vergessen. Keine Frage: Strukturell und handwerklich sind die Geschichten solide gemacht. Camilla Läckberg nutzt zeitlich verschiedene Ebenen, Rückblicke und Anspielungen auf noch Kommendes sehr geschickt und spannungsfördernd als Cliffhanger. An ihrer Sprache ist nichts auszusetzen, aber es gibt auch nichts, was sie besonders aus- und kennzeichnet: kein Augenzwinkern, keine Ironie, keine „Abendpresse-Prosa“ wie bei Liza Marklund seinerzeit (die viele auch nicht mochten, aber sie war neu und hat Impulse gegeben). Und auch inhaltlich ist sie ein Schritt zurück, denn sie hat dem bereits Bestehenden nichts Neues hinzugefügt.
|
|
 |
|
 |
|
Ihre Intrigen und Plots sind gut und spannend, bieten aber nicht das intellektuell-komplexe Gedankengebäude eines Arne Dahl, erzählen nichts, was nicht schon Mankell moniert hat oder bei ihm angelegt ist, und haben nicht die innovative Verspieltheit eines Håkan Nesser. Ähnliches gilt für ihre Figuren. Sie sind nicht in der gleichen Art kämpferisch und polarisierend wie Liza Marklunds in ihren besten Zeiten, es fehlt ihnen die subtile Psychologie einer Karin Fossum oder einer Karin Alvtegen. Moralisch und politisch wird keine neue Position bezogen und artikuliert, so wie es damals Henning Mankell tat. Bei aller dargestellten Abgründigkeit, mit Camilla Läckberg befindet man sich letztlich immer auf sicheren Boden. Literarische Grenzüberschreitungen gibt es bei ihr nicht, keine neuen Sichtweisen, keine Ambiguität und keine Mehrdeutigkeit. Alles Brüchige dient letztlich nur dazu, den nächsten Krimiplot zu schmieden.
Keine Brüche, keine Ambiguität, aber viel Privates
Tatsächlich rückt das Private in bisher - selbst bei Mankell - nicht gekanntem Ausmaß in den Vordergrund. Während bei Mankell Wallanders Familienleben eher Spotlightartig beleuchtet wird und den politischen, gesellschaftskritischen Aspekt auf der privaten Ebene widerspiegelt und als Reflexionsebene von existentieller Bedeutung dient, fehlen bei Camilla Läckberg diese Meta-Bezüge. Es sei denn, man postuliert, in skandinavischer Tradition, dass das Politische privat ist und das Private politisch. Dann aber zeigt Läckberg ein konservativ zu nennendes Frauen- und Familienbild, das möglicherweise der im Vergleich zu Deutschland weit vorangeschrittenen Emanzipation und Gleichstellung der Frauen im Berufs- und Alltagsleben zu verdanken ist. Erst wenn eine Gesellschaft soweit gekommen ist (und nicht wie Deutschland Hitler und seine „Familienpolitik“ hatte), kann ein ursprünglich konservatives Bild von Familie, Frau und Beruf so selbstverständlich in epischer Breite und ohne großen Aufschrei und Widerspruch in der Öffentlichkeit geschildert, ja fast schon verherrlicht werden. Dieses Bild steht in deutlichem Kontrast zu den Frauen- und Rollenbildern, die etwa Liza Marklund mit Annika Bengtzon oder Kjell Eriksson mit Ann Lindell entwerfen, und dennoch nimmt ganz sicher auch Camilla Läckberg für sich in Anspruch, gesellschaftliche Realität abzubilden. Doch alles Gesellschaftskritische, alles Brüchige in den Figuren (Annika Bengtzon ist ja alles andere als unkompliziert und auch ihre Beziehung zu ihrem Mann nicht ohne Spannungen, Ann Lindell ist alleinerziehende Mutter) scheint bei Läckberg abwesend, ausgelöscht. Gesellschaftskritik wird bei Läckberg, wenn sie denn geäußert wird, reflexartig von den Protagonisten geäußert. Wo Kurt Wallander melancholisch räsoniert und Annika Bengtzon pathetisch und mit Emphase polemisiert, entsteht bei Läckberg ein Vakuum. Besonders augenfällig ist dies in „Olycksfågeln“, dem Folgeroman zu „Die Töchter der Kälte“.
Kritik als Reflex – nicht aus existentieller Not geboren
In einer verschärften Big-Brother-Das-Dorf-Version fällt dort die Produktion "Fucking Tanum" in Patricks Polizeirevier ein und natürlich verabscheuen Patrick, sein Kollege Martin und alle Personen in deren sozialen Umfeld das menschenunwürdige Zurschaustellen der "Fucking Tanum"-Teilnehmer. Was aber bei anderen Autoren von existentieller und essentieller Bedeutung auch im metaphorischen Sinn für das Romangeschehen wäre, dient bei Läckberg nur als Kulisse zu einem Mord, der aber nichts mit "Fucking Tanum" als gesellschaftlichem Phänomen zu tun hat – und damit fällt sie hinter dem bereits Erreichten zurück, und man konstatiert: Mit dieser Art Konservativismus provoziert Camilla Läckberg ihre Kritiker genauso wie seinerzeit Liza Marklund mit ihrer weitaus progressiveren Annika Bengtzon.
Gut komponiert, spannend konstruiert
Tatsache aber bleibt, dass „Die Töchter der Kälte“ ein gut komponierter, spannend konstruierter Krimi ist, doch auch, dass das Bessere der Feind des Guten ist: Camilla Läckbergs Krimi ist in jeder Hinsicht gut gemacht – aber das Problem ist: es hat schon Besseres, im Sinne von innovativ, kritisch und impulsgebend, gegeben. Grund für verbale Entgleisungen wie die von Leif GW Persson sollte das dennoch nicht sein, denn diese sind geschmacklos und herabwürdigend. Über Literatur wie über Kunst im Allgemeinen lässt sich auch ohne dies trefflich und zu beiderseitigem Befruchten streiten. Camilla Läckbergs Erfolg ist ohnehin indiskutabel: Mit 1 Million Gesamtauflage kann man die Schwedin getrost zu den ganz großen Krimiautorinnen Skandinaviens zählen.